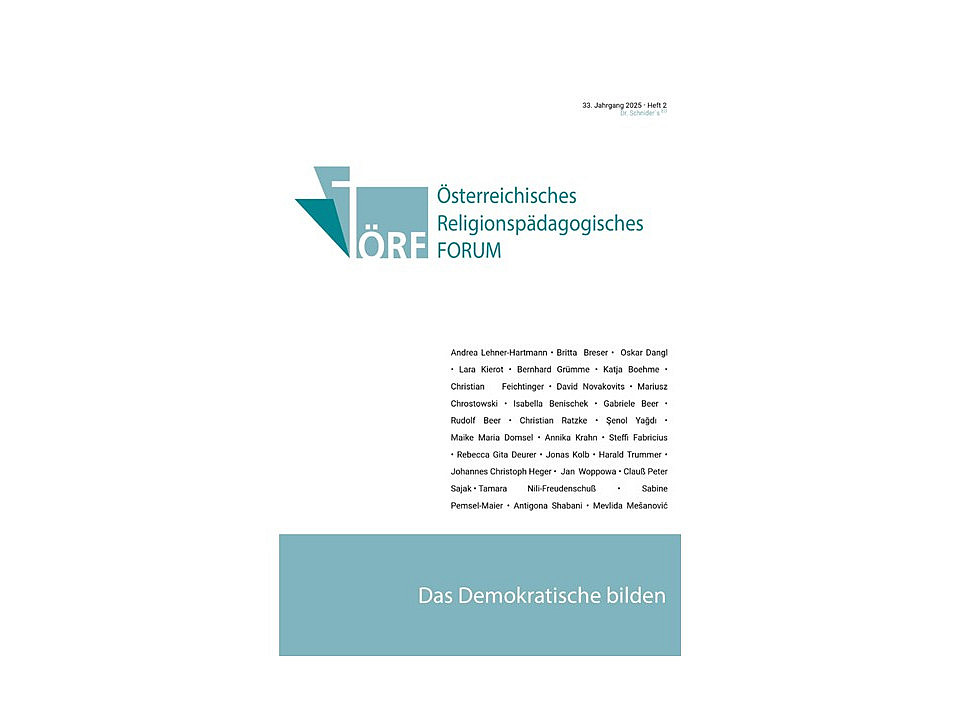Demokratie steht gegenwärtig in vielfacher Hinsicht unter Druck. Schlagzeilen wie „Kippt diese Demokratie?“, „Stirbt die Demokratie in diesem Jahr?“ oder „Sind wir überhaupt eine liberale Demokratie?“ weisen auf die Dringlichkeit aktueller Diskurse zur weiteren Demokratie-Entwicklung hin und werfen grundlegende Fragen zur Zukunft demokratischer Gesellschaften auf. Demokratische Prinzipien, Strukturen und Prozesse, ebenso wie die daran beteiligten (Bildungs-)Institutionen und Akteurinnen, sehen sich in einem Spannungsfeld unterschiedlicher Krisen herausgefordert – sei es durch den Vertrauensverlust in demokratische Institutionen, die Erosion politischer Repräsentation, durch postdemokratische Passivierung und die zunehmende Entkopplung von gesellschaftlichem Zusammenhalt und politischer Teilhabe. Das Versprechen des demokratischen Wohlfahrtsstaates – ein gesichertes Leben in einer geordneten, gerechten Gesellschaft – scheint unter den Bedingungen multipler Krisen nicht mehr ohne tiefgreifende gesellschaftliche, politische und individuelle Veränderungen einlösbar. Vor diesem Hintergrund ist Demokratie nicht bloß als Herrschaftsform zu verstehen, die sich an Mehrheiten orientiert, sondern – im Sinne John Deweys – als eine dynamische Lebensform, die „entdeckt und wiederentdeckt, neu gemacht und reorganisiert“ und in „ständig erneuerter Kraftanstrengung gelernt werden muss“. Sie ist kein statisches Konstrukt, sondern eine „wandelbare Ausformung unter zeitkulturellen Bedingungen, Anforderungen und Phänomenen“. Diese Perspektive erfordert eine kritische Reflexion unterschiedlicher Gesellschaftsbereiche, Institutionen und Akteurinnen zur Demokratie, zum Demokratischen und zur Demokratisierung sowie eine multiperspektivische Diskussion demokratischer Entwicklungen und (Ent-)Demokratisierungsprozesse in sämtlichen gesellschaftlichen Feldern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Diagnose einer sogenannten „Demokratiedämmerung“ zwar reale Herausforderungen benennt, aber auch die Vorstellung hervorbringt, es habe jemals „intakte“ Demokratien gegeben. Demgegenüber erscheint es produktiver, Demokratie als ein lernbedürftiges, stets umkämpftes, konflikthaftes und nie abgeschlossenes Projekt zu begreifen, das kontinuierlich neu verhandelt und gelernt werden muss. Gerade vor diesem Hintergrund kommt der Demokratiebildung eine besondere Bedeutung zu. Während dem Bildungswesen in öffentlichen Debatten häufig eine zentrale Verantwortung zugeschrieben wird, muss das Demokratische als Bildungsaufgabe stets breit gedacht werden. Dazu gehören – neben der (hoch)schulischen Bildung – auch andere gesellschaftliche Bereiche und Institutionen wie Politik, Verwaltung, Gesundheitswesen, Religionsgemeinschaften, Haftanstalten, Vereine, Sportorganisationen, Jugendzentren, Altenheime etc. In unterschiedlichen Ausprägungsformen und Gestaltungsvarianten haben sie das Potenzial, das Demokratische im Alltag sichtbar und wirksam zu machen sowie demokratische (Selbst-)Bildungsprozesse zu initiieren. Sie alle tragen zur Gestaltung, Förderung oder auch zur Behinderung demokratischer Entwicklungen in Zeiten multipler Krisen bei. Insbesondere der religiöse Bereich eröffnet dabei ambivalente Perspektiven: Religionsgemeinschaften können sowohl demokratische Bildungsimpulse geben als auch in strukturellem oder inhaltlichem Widerspruch zu demokratischen Prinzipien stehen. Der Religionsunterricht sowie die theologischen Disziplinen – insbesondere die Religionspädagogik – sind deshalb aktuell gefordert, sich mit dem Verhältnis von Religion und Demokratie differenziert auseinanderzusetzen und die Bildung des Demokratischen aktiv mitzugestalten. Das vorliegende Heft nimmt diese vielfachen Herausforderungen auf und lädt zu einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Demokratiebildung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten ein. Ziel dieses Heftes ist es, empirische Erkenntnisse, theoretische Grundlegungen und innovative Impulse für eine demokratieorientierte Bildungsarbeit zusammenzutragen und weiterzuentwickeln. Dabei soll auch der Blick auf antidemokratische Tendenzen geschärft und deren Bearbeitung im Rahmen von Bildungsprozessen nicht vergessen werden.
Wir bedanken uns im Namen des Editorialboards sehr herzlich für Ihr Interesse an den Beiträgen dieser Ausgabe des ‚ÖRF‘und wünschen eine anregende Lektüre. Zugleich laden wir Sie ein, die Zeitschrift in Ihrem Umfeld entsprechend bekannt zu machen bzw. durch Links auf die beiden Publikationsplattformen, auf denen das ÖRF zeitgleich erscheint, http://unipub.uni-graz.at/oerf und http://oerf-journal.eu,aufmerksam zu machen – besten Dank dafür!
Rückmeldungen und Kritik zur Zeitschrift, die beide willkommen und erbeten sind, richten Sie bitte an oerf.redaktion(at)uni-graz.at.
Gleichzeitig nehmen wir die Veröffentlichung der ÖRF-Herbstausgabe auch zum Anlass, um auf unsere aktuellen Call for Papers hinzuweisen. Wir freuen uns auf Ihre Ankündigungen per Mail an oerf.redaktion(at)uni-graz.at.
Prof.in Dr.in Andrea Lehner-Hartmann, Universität Wien
Prof.in Dr.in Britta Breser, Universität Wien
Prof. Dr. Oskar Dangl, Universität Wien
(Verantwortlich für die ÖRF-Ausgabe 2025/2)